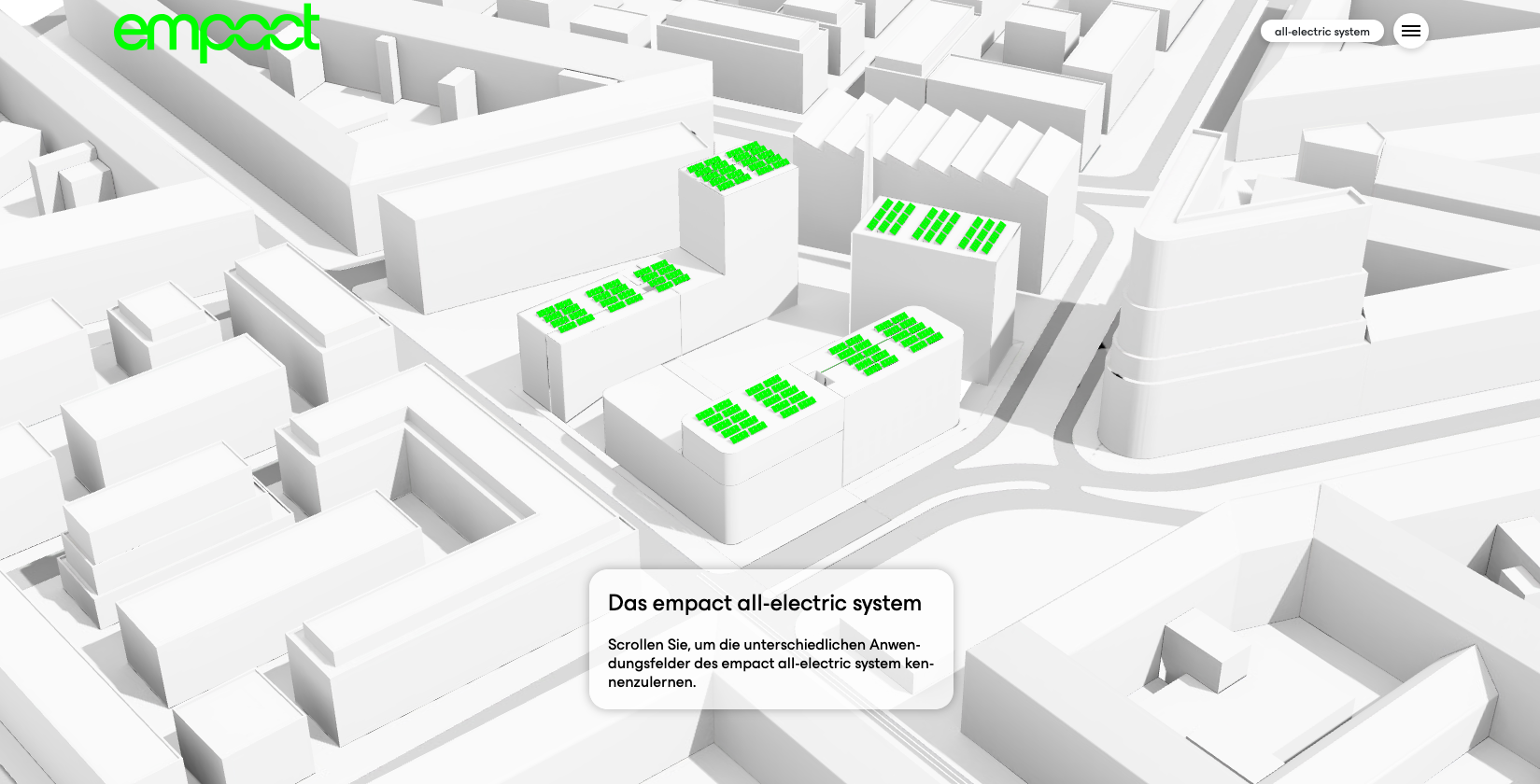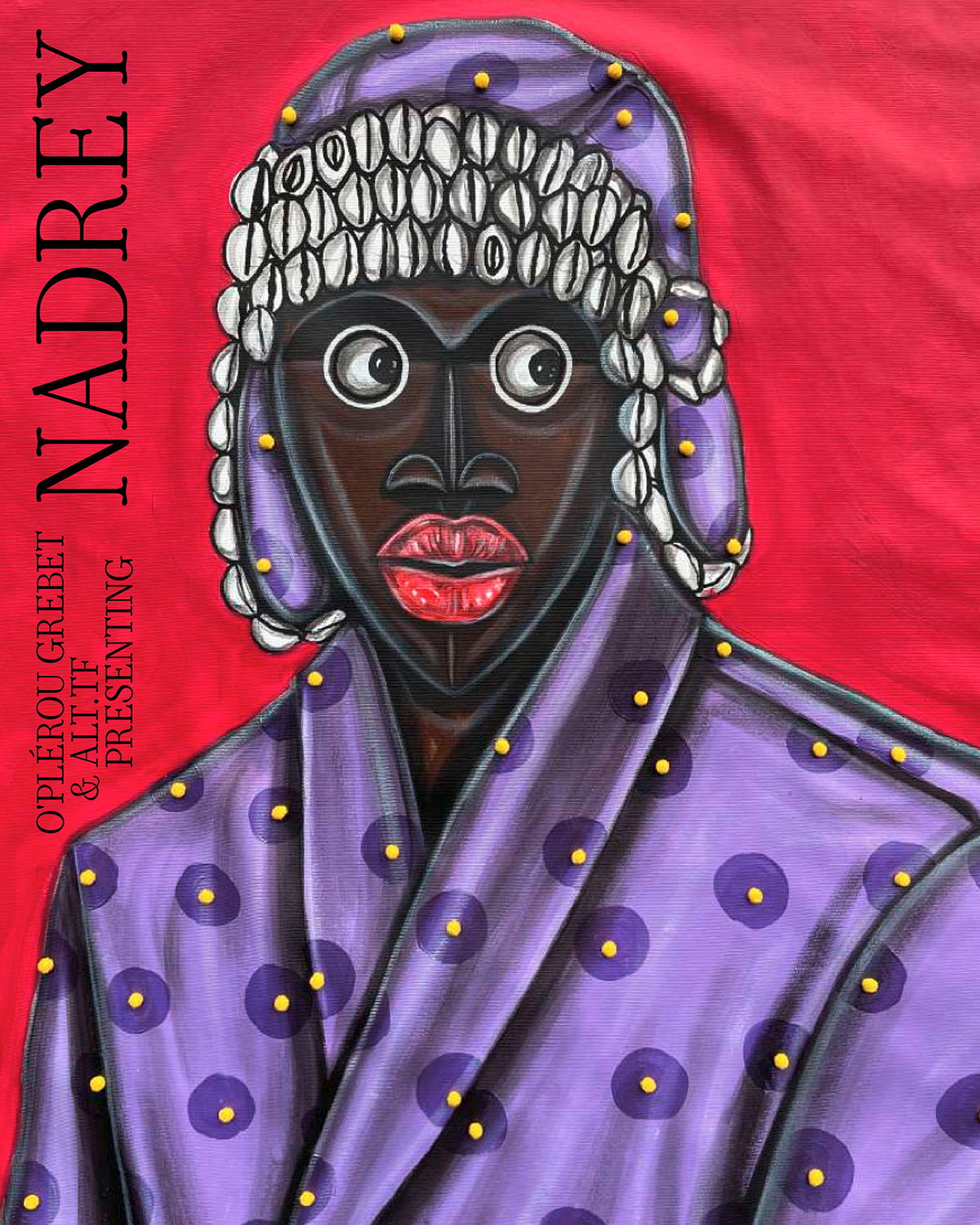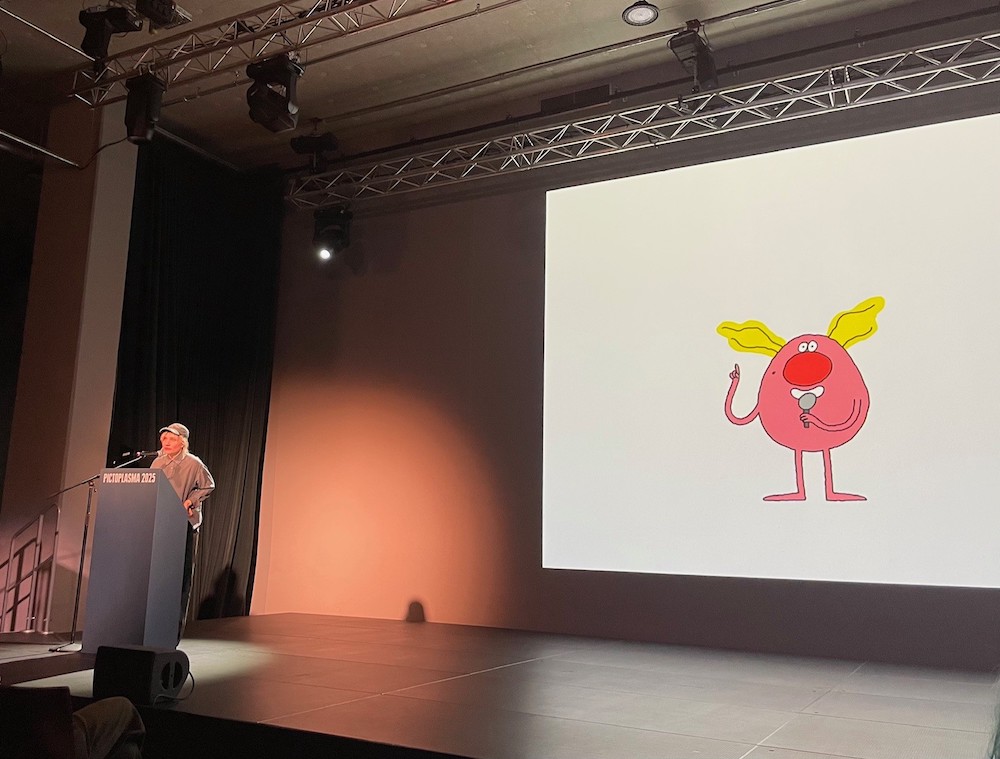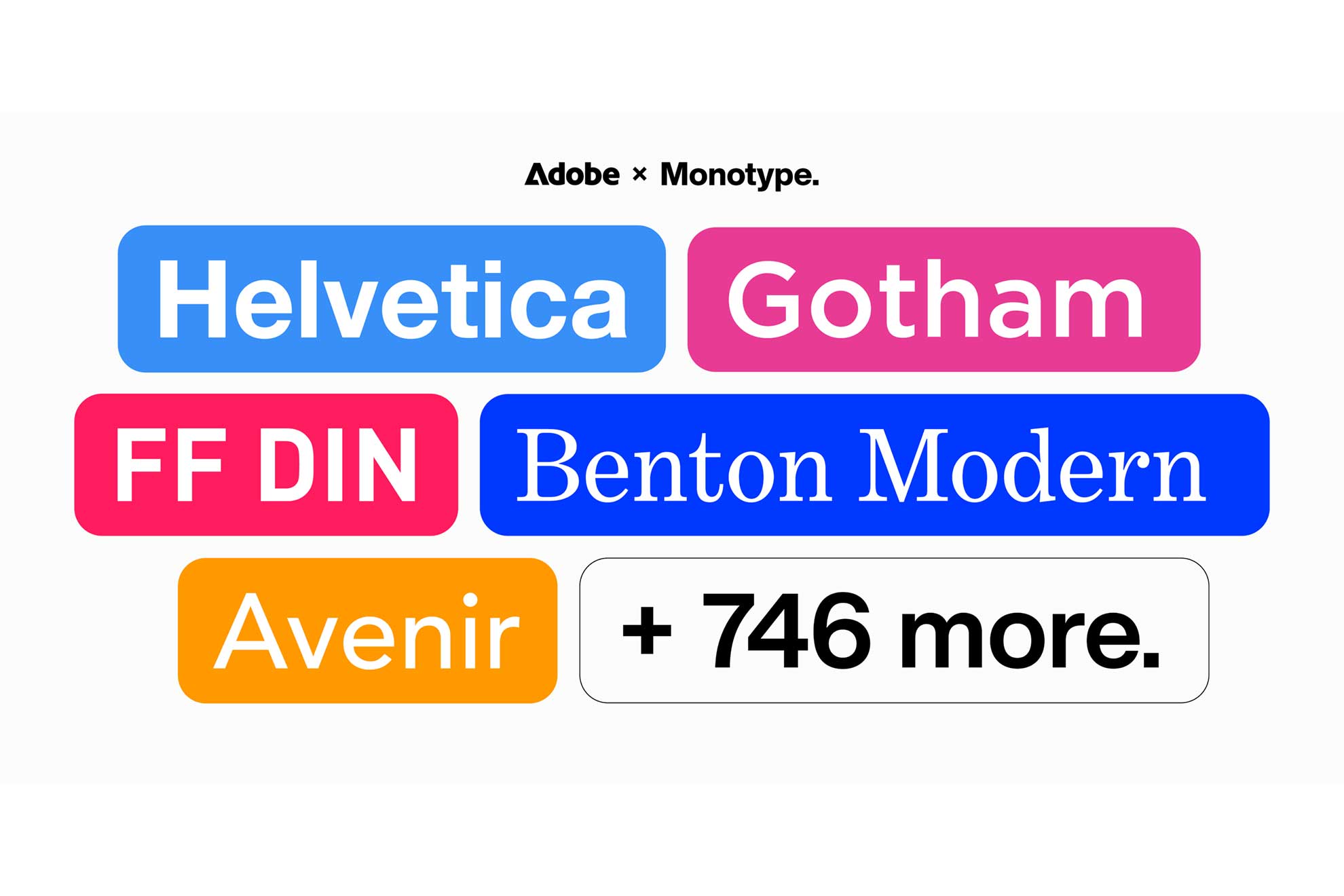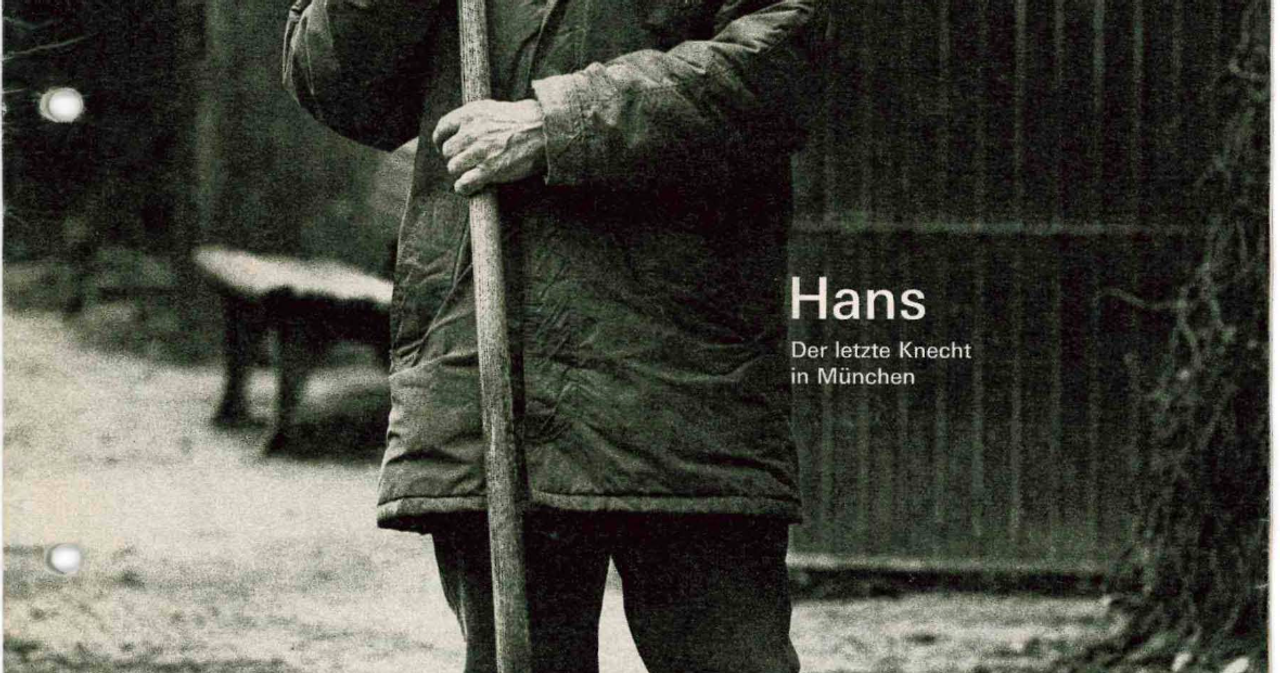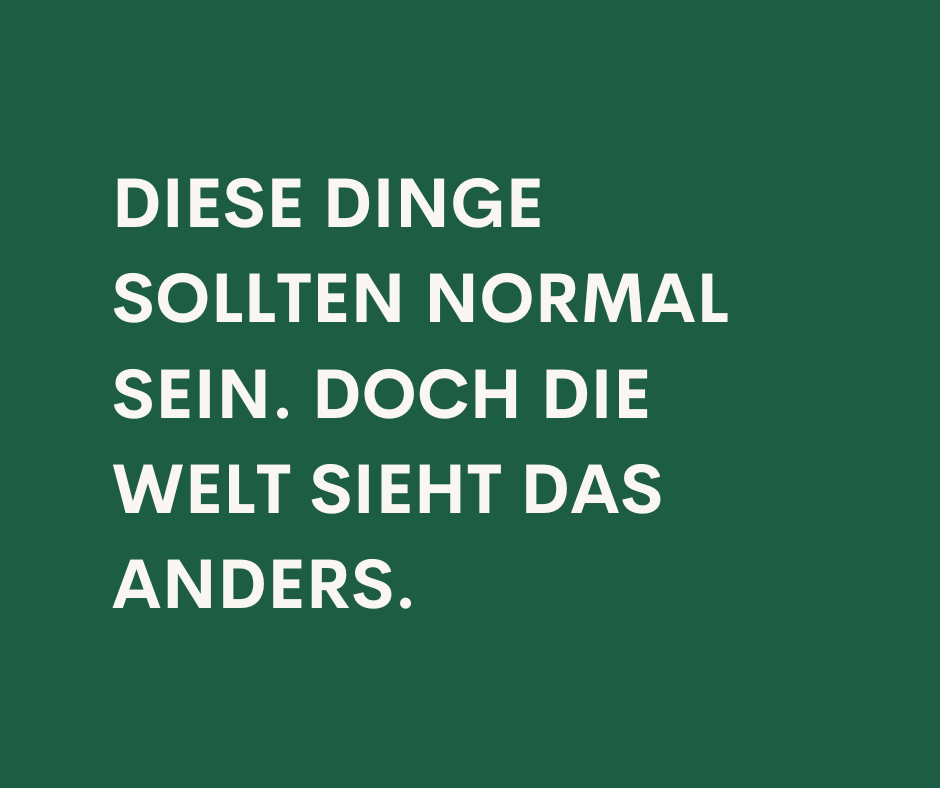Die unsichtbare Krankheit : 4 Betroffene erzählen, wie sich ihr Leben mit ME/CFS verändert hat
In Deutschland hat sich die Zahl der ME/CFS-Betroffenen durch die COVID-19-Pandemie von ungefähr 250.000 auf 500.000 verdoppelt. Wie es sich anfühlt, wenn das Leben an einem vorbeizieht, erzählen vier Patientinnen im Interview mit BRIGITTE.

In Deutschland hat sich die Zahl der ME/CFS-Betroffenen durch die COVID-19-Pandemie von ungefähr 250.000 auf 500.000 verdoppelt. Wie es sich anfühlt, wenn das Leben an einem vorbeizieht, erzählen vier Patientinnen im Interview mit BRIGITTE.
"Wir verlieren unser Leben, ohne zu sterben". Dieser Satz steht auf einem Schild, das eine junge Frau bei einer "LiegendDemo" vor dem Berliner Rathaus hochhält. Sie heißt Greta, ist 32 Jahre jung und hat für heute ein großes Ziel: Sie will mit den anderen Anwesenden auf die Krankheit ME/CFS aufmerksam machen.
Wenn das Leben an einem vorbeizieht
ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue Syndrom) ist eine schwere, noch unheilbare neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt. Ein Viertel aller Betroffenen ist bettlägerig. Auch für Greta erfordert es ein hohes Maß an Energie, an einer Demo teilzunehmen. "Es kann gut sein, dass ich die nächsten sieben Tage gar nicht mehr aufstehen kann", erklärt sie. Ein Crash, also eine Verschlechterung der Symptome für einen unbestimmt langen Zeitraum, komme oft erst rund einen Tag nach der körperlichen Anstrengung – und dann gehe gar nichts mehr. Deshalb muss sie mit ihrer Energie gut haushalten.
Wie ungefähr die Hälfte aller ME/CFS-Patient:innen wird Greta nach einer Corona-Infektion im Herbst 2020 nicht mehr vollständig gesund. Auch Monate nach ihrer akuten Covid-Erkrankung fühlt sie sich abgeschlagen, hat Muskelschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und Nebel im Kopf. Sie verbringt die meiste Zeit des Tages in ihrem abgedunkelten Zimmer im Bett. Licht und Geräusche verschlimmern ihre Symptome. Nach einer langen Ärzt:innen-Odyssee erhält sie im Frühling 2022 die Diagnose ME/CFS.
Damit ist Greta nicht allein. In Deutschland kletterte die Zahl der ME/CFS-Betroffenen durch die COVID-19-Pandemie von ca. 250.000 auf 500.000. Professorin Carmen Scheibenbogen vom Institut für Medizinische Immunologie an der Charité bestätigt das gegenüber "Tagesschau": "Corona ist inzwischen die häufigste Ursache für ME/CFS bei unseren Patienten."
ME/CFS kann nach Virusinfektionen wie Covid auftreten. Sie gehört daher auch zu den Folgeerkrankungen von Long Covid. Erkrankte haben ausgeprägte körperliche und kognitive Symptome und eine sehr niedrige Lebensqualität. 60 bis 75 Prozent aller Erkrankten sind arbeitsunfähig, viele davon sind an Haus oder Bett gebunden. Leitsymptom ist eine schwere Belastungsintoleranz mit Symptomverschlechterung nach Alltagsaktivitäten (PEM = Post-Exertionelle Malaise).
BRIGITTE hat neben Greta mit vier weiteren ME/CFS-Betroffenen gesprochen, die bereit waren, ihre Geschichten zu teilen.
Charlotte, 27

© privat
Charlotte liegt in ihrem Bett, während ich mit ihr spreche. Als ich sie frage, ob sie mir erzählen möchte, wie sich ihr Alltag mit ME/CFS verändert hat, sprudelt es nur so aus ihr heraus. An ihren alten Alltag könne sie sich gar nicht mehr erinnern, es fühle sich so lange her an. "Ich bin aufgestanden, nach dem Frühstück mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Dann Vorlesungen. Später habe ich gekocht und abends noch mal was mit Freund:innen unternommen." Jetzt sehe das anders aus.
"Ich brauche mindestens 12 Stunden Schlaf und wenn ich morgens aufwache, bin ich gar nicht erholt. Die erste Stunde kann man mich meist nicht ansprechen, da checke ich nichts. Wenn mein Kopf dann halbwegs funktioniert, schaue ich, wie es mir heute geht. Wie viel Energie habe ich? Wie schwer sind die Symptome? ME/CFS ist ja so eine dynamische Krankheit, jeder Tag kann anders sein."
Meistens versuche sie dann kleine Dinge zu erledigen und dazwischen zu pausieren. Duschen, dann ausruhen. Frühstücken, dann ausruhen. "Wenn es ein guter Tag ist, kann ich abends noch eine Kleinigkeit machen oder mal ein Treffen mit Freund:innen einplanen", fügt sie hinzu.
Charlotte ist wie alle Betroffenen, mit denen ich spreche, Expertin für ihre Krankheit geworden. Sie erklärt mir, dass man ME/CFS in Unterkategorien einteilen kann. Es gebe milde ME, moderate ME, schwere ME und sehr schwere ME. "Ich habe moderate ME. Zu Hause kann ich mich relativ frei bewegen, habe keine Probleme aufs Klo zu gehen und so." Aber sogar mild Betroffene hätten im Vergleich zu einer gesunden Person 50 Prozent mehr Einschränkungen – und könnten ihren Alltag meist ohne Hilfe nicht bewältigen.
"ME/CFS ist jetzt mein Leben"
Ihre Diagnose erhielt die 27-Jährige erst Anfang 2023. Vorher wurde ihre Erkrankung wie bei vielen Betroffenen psychologisiert. Dank ihrem Vater, einem Hausarzt, konnte sie Kontakt zu einem Spezialisten aufnehmen, ein Privileg. Auch unterstützen ihre Eltern sie finanziell. Das Glück haben viele nicht. Behandlungen sind auch oft eine Frage des Geldes, weil man vieles privat bezahlen muss.
"Man will nicht die Person sein, die immer nur über ihre Krankheit redet, aber das ist mein komplettes Leben. Alles dreht sich darum." Charlotte lacht. Ich frage mich, woher sie die Kraft nimmt. Sie sagt: "Ich habe den Anspruch, jetzt, wo es mir ein bisschen besser geht, den Menschen, die schwer und schwerst betroffen sind, eine Stimme zu geben. Es ist so unvorstellbar schlimm, wenn du den ganzen Tag im Bett liegst und nicht mal Licht tolerieren kannst. Manche müssen künstlich ernährt werden, können nicht auf Toilette und manche sterben auch an ME, weil der Körper einfach überfordert ist. Meist an einem Herzstillstand. Aber es gibt auch Suizid und assistierten Suizid."
Ich frage sie, was ihr Hoffnung gibt. "Mit der Hoffnung ist das so eine Sache, wenn man die ganze Zeit hängengelassen wurde", sagt sie. Meistens seien es eher andere Menschen, die ihre Hoffnungen auf sie projizieren und ihr gut zureden à la "Das wird schon wieder, du wirst wieder gesund", weil sie nicht damit klarkommen, dass es ihr so schlecht geht. "Am meisten Halt gibt mir mein Umfeld, meine Freund:innen und mein Freund Simon. Der sagt: 'Ich bleibe bei dir, egal, was ist!' Wenn ich nicht mehr kann, dann denke ich 'Ich bleibe jetzt einfach für die am Leben'."
Dunja, 52

© privat
Nicht alle Betroffenen haben Menschen, die sich kümmern. Dunja wohnt in Hamburg und ist alleinstehend. Ihre Familie lebt 120 Kilometer weit weg. "Da kann niemand mal schnell vorbeikommen und mir unter die Arme packen", bestätigt sie. Sie sei aus diesem Grund dankbar für jeden Lieferdienst, der sie mit Dosenravioli und Eintopf versorge. "Wobei ich manchmal auch zu schwach bin, die Dose zu öffnen." Dunja wirkt während unsers Telefonats tough, eine 'Steh-auf-Frau'. Ihren Humor hat sie – so scheint es – nicht an die Krankheit verloren.
Die 52-Jährige war bis zu ihrer Covid-Infektion im Außendienst für eine Kosmetikfirma tätig. Sie sei noch angestellt und habe die Hoffnung zurückzukehren – in welcher Form auch immer. Beinahe das Erste, dass sie mir erzählt, ist, dass sie morgen einen Friseurtermin habe, auf den sie sich freue. Sie habe sich schon den ganzen Tag im Dunkeln verschanzt, um sich dafür auszuruhen. Deswegen könne sie nun auch gut mit mir sprechen. "Da ist noch ein bisschen Energie da", erklärt sie.
Dann beginnt Dunja noch mal ganz von vorne mit ihrer Geschichte: "Meine Corona-Infektion war kaum spürbar. Ich hatte wenig Symptome. Ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch, Workaholic würde ich fast sagen. Sobald der Test negativ war, bin ich wieder arbeiten gegangen. Ich habe alle Symptome ignoriert, bis ich ein halbes Jahr später wirklich gar nichts mehr konnte. Dann bin ich erst zum Arzt. Der hat zuerst ein Burnout vermutet. Erst Anfang des Jahres 2024 habe ich die Diagnose Chronisches Fatigue Syndrom (CFS) erhalten."
"Ich habe es nicht mal zur Toilette geschafft"
Bis dahin habe sie nicht gewusst, was mit ihr nicht stimme. Nur durch eigene Recherche im Internet und in Foren sei sie auf die Idee bekommen. Das sei fatal gewesen. "Ich habe mich ständig überfordert, bis ich einen heftigen Crash hatte. Da habe ich drei Wochen lang im Bett gelegen und fast gar nichts gegessen und nichts getrunken, weil ich es nicht geschafft habe, zur Toilette zu gehen. Es war furchtbar."
Sogenannte Crashs gilt es zu vermeiden, weil es sein kann, dass sich der Körper danach nicht mehr erholt und sich die bestehenden Symptome auf Dauer verschlechtern und dazu führen, dass es nicht nur tage- sondern wochenlang sehr viel schlechter geht. Oft müsse man in diesen Fällen wirklich im dunklen Zimmer liegen, erklärt Carmen Scheibenbogen gegenüber "Tagesschau".
Das weiß Dunja jetzt. Sie beschäftige sich seit dem Vorfall mit Pacing. "Beim Pacing geht es darum, möglichst nicht mehr als 50 Prozent der Grundenergie zu verbrauchen. Das heißt, ich beschränke mich im Moment wirklich nur auf das Notwendigste."
Ich merke, dass es ihr schwerfällt, als leistungsorientierter Mensch nicht mehr an ihre Grenzen gehen zu dürfen. Aber dass in ihr auch Hoffnung schlummert, es könne wieder besser werden. "In meiner romantischen "Rosamunde Pilcher"-Welt kehre ich irgendwann an meinen Arbeitsplatz zurück. Und deswegen darf ich bitte keine Post von meinem Arbeitgeber bekommen, in der steht 'So, sorry, wir trennen uns.' Das wäre schwer."
Eva, 46

© privat
Es ist früher Abend, als ich Eva anrufe. Sie sitzt im Garten. Ich frage sie, wie es ihr geht. Sie sagt, "heute ist einer der besseren Tage." Die 46-Jährige ist Mutter eines Sohns und einer Tochter und selbstständig als Physio-Therapeutin tätig. Auf meine Frage, wie sie das schafft, antwortet sie: "Meine eigene Praxis ermöglicht mir nach eineinhalb Jahren Arbeitsunfähigkeit wenigstens ab und zu wieder irgendwas anderes zu machen, als mich mit meiner Krankheit zu beschäftigen."
Zu ihrer alten Arbeitsstelle hätte sie nicht zurückgekonnt. "Jetzt teile ich mir es so ein, wie ich es brauche. Ich mache einen Patienten und dann lege ich mich eine Stunde lang hin und dann mache ich den nächsten Patienten und lege mich wieder hin." Vor ihrer Covid-Infektion hätte ihr Alltag ganz anders ausgesehen. "Ich war wie ein wie ein Duracellhase, immer auf 180 Prozent."
30.000 Euro für Diagnostik? Betroffene zahlen oft selbst
Dass es ihr inzwischen wieder so gut gehe, dass sie an manchen Tagen ein wenig arbeiten könne, sieht sie nicht als Selbstverständlichkeit an. Zu 80 Prozent sei es aber Eigenarbeit gewesen. "Ich habe insgesamt an die 30.000 Euro ausgegeben für Diagnostik und Analysen, alles aufgrund von Dingen, die ich aus verschiedensten Facebook-Gruppen oder Studien erfahren habe. Ich habe meine Antikörper testen lassen. Ich habe eine Immunabsorption auf eigene Kosten gemacht.
Eva hat zwei Kinder, eine zehnjährige Tochter, der Sohn ist 16, also schon recht selbstständig. Trotzdem frage ich mich, wie sie damit zurechtkommen, dass ihre Mutter von einen auf den anderen Tag schwer krank wurde. "Mein Sohn ist mitten in der Pubertät, der interessiert sich nicht so wirklich dafür. Der macht schon sein eigenes Ding", sagt sie und lacht. "Meine Tochter macht sich immer ein bisschen Sorgen. Ich brauche nur ein wenig komisch zu atmen, dann heißt es 'Mama alles okay, alles okay?'."
Wenn Eva allerdings eine Pause braucht, gibt es keine Diskussion. "Wir haben ein Ampelsystem entwickelt, Grün heißt alles in Ordnung, Gelb heißt bald muss ich eine Pause machen und Rot heißt jetzt muss ich sofort aufhören und mich hinlegen. Das wird auch akzeptiert."
Was ihr helfe, weiterzumachen, sei vor allem ihre Lebenseinstellung. "Ich bin im Hier und Jetzt. Wenn ich einen guten Moment habe, genieße ich den in vollen Zügen. Wenn ich einen schlechten Moment habe, hoffe ich natürlich auf den nächsten guten. Ich bin mir bewusst, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt viele Menschen, die sind noch viel schwerer betroffen als ich."
Bianka, 55
Mit Bianka, einer schwer betroffenen ME/CFS-Patientin, spreche ich nicht persönlich. Sie mailt mir ihre Geschichte. Telefonieren koste sie zu viel Kraft, erklärt sie mir. Bianka ist 55 Jahre alt, hat Kinder, einen Mann und zwei Hunde. Eine Covid-Infektion im November 2020 stellt das Leben der Palliativ-Krankenschwester völlig auf den Kopf.
"Meine Tage sind durch starke Kopfschmerzen, Muskel/Gelenkschmerzen, Schwindel, Fatigue, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Sehstörungen und kognitive Einschränkungen geprägt", schreibt sie. Lesen und Fernsehen gehe schon lange nicht mehr, das sei zu viel Input – zu laut und zu bunt. "Mein Mann übernimmt mittlerweile vieles, was ich selbst nicht mehr kann. Er ist an meiner Seite, er erklärt mir, wie etwas schmeckt oder riecht. Er steht nachts auf und begleitet mich zur Toilette oder versucht die Schmerzen in den Beinen durch Einreibungen zu lindern."
"Meine Welt ist kleiner geworden"
Das höre sich sehr düster an, es gäbe auch bessere Tage. Manchmal sei Essen gehen oder der Besuch der Kinder möglich. Nur für ein bis zwei Stunden, aber immerhin. Leider müsse sie dann oft mit einer Verstärkung der Symptome rechnen, sodass sie für zwei bis drei Tage nur liegen könne. Mit dem Rollator oder E-Mobil könne sie manchmal noch kleine Strecken bewältigen, an schlechten Tagen sei aber schon der Weg vom Sofa zur Toilette zu viel. "Ich habe einen Pflegegrad, eine Haushaltshilfe unterstützt meinen Mann und unsere Kinder, Nachbarn und Freunde helfen, wo sie können."
Auf die Frage, was sie glücklich macht, schreibt Bianka: "Ich liege viele Stunden am Tag auf unserer geschützten Terrasse, genieße den Jahreslauf, beobachte die Pflanzen- und Tiervielfalt. Wenn unsere Kinder und Freunde verreisen, "reise" ich über Whatsapp-Bilder mit. Ich habe meine Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und meine Bestattung angepasst – ich bin im Reinen mit mir. Meine Welt ist kleiner geworden. Aber ich bin dankbar für meinen Mann, unsere Kinder, unsere Hunde und mein Leben."