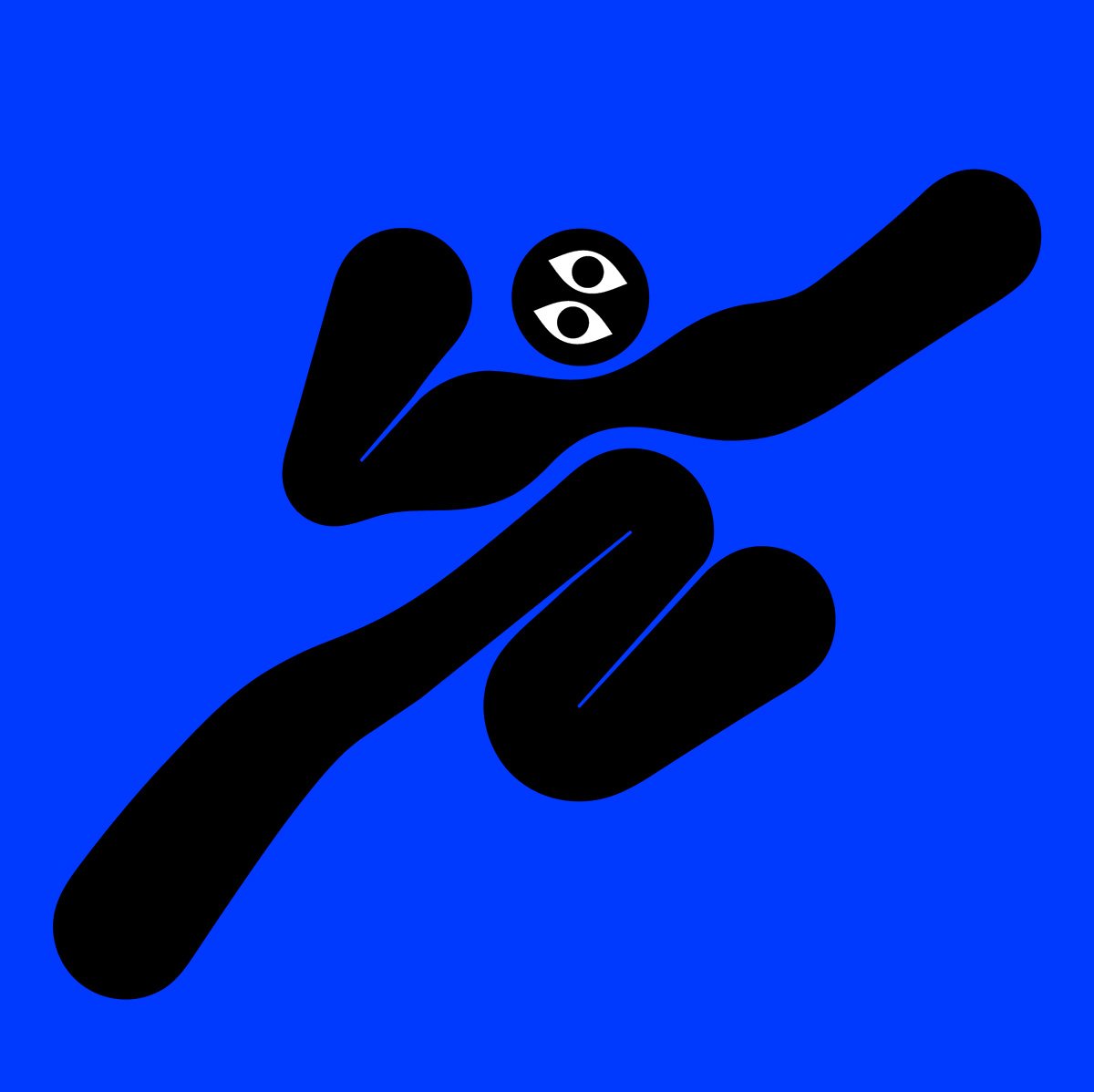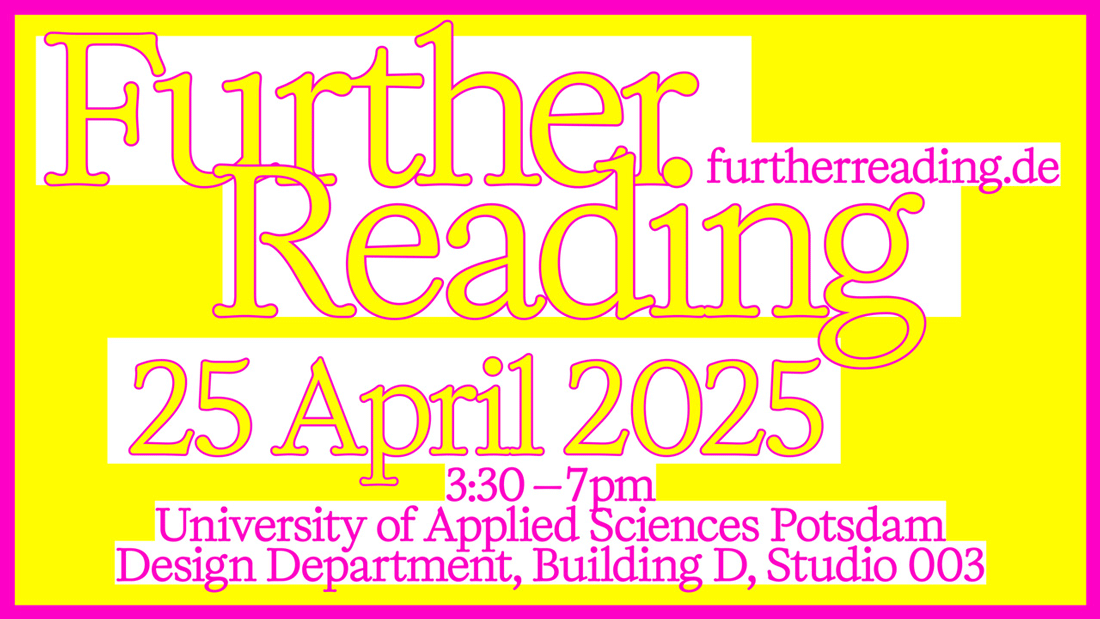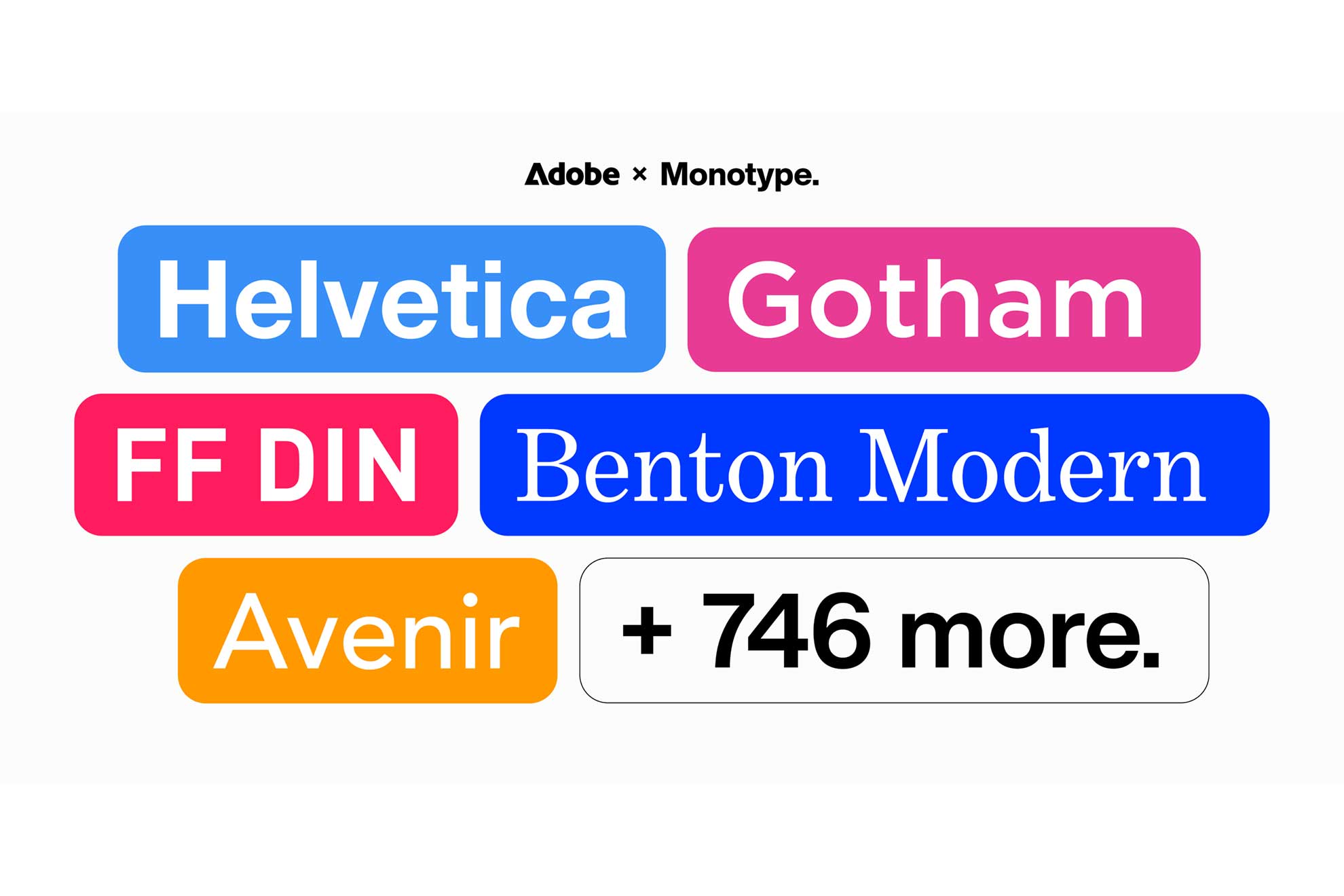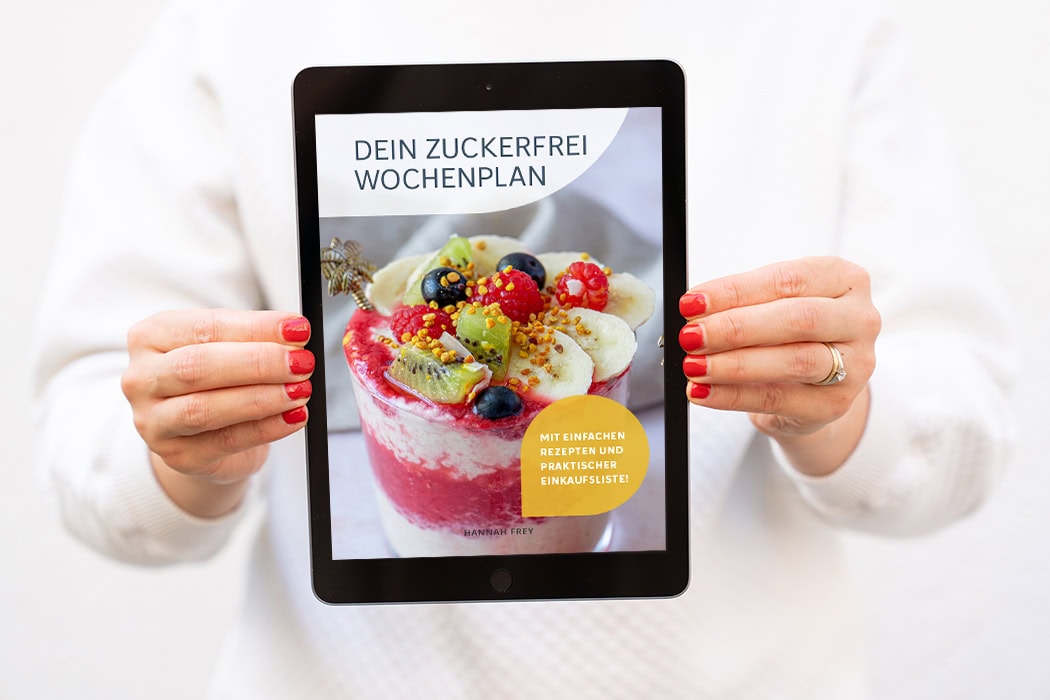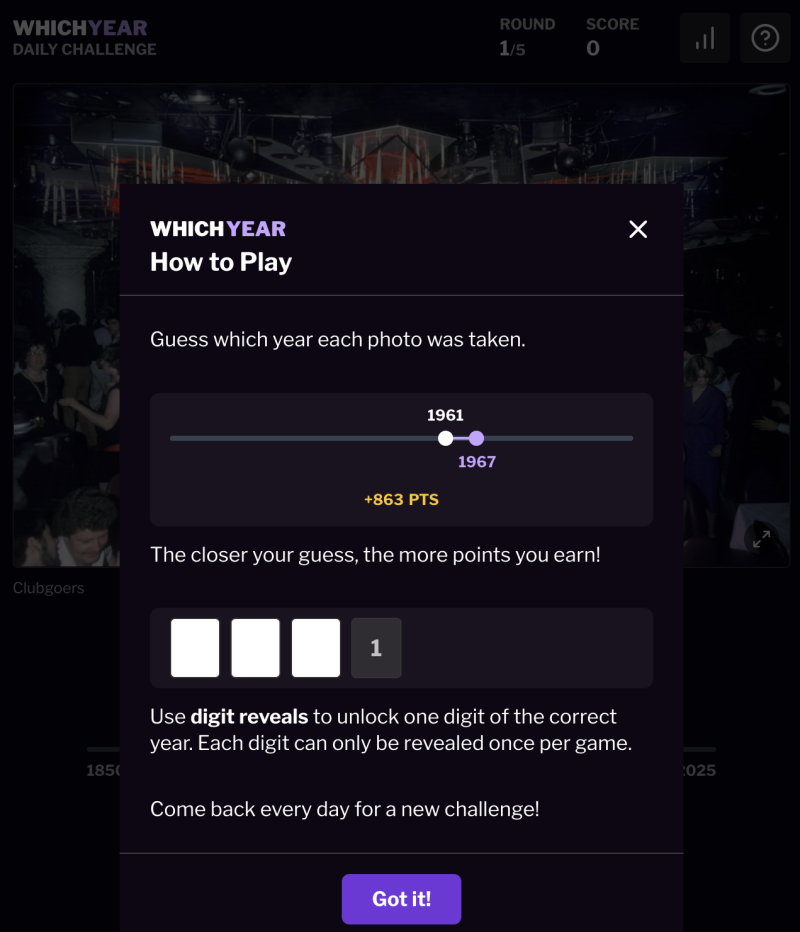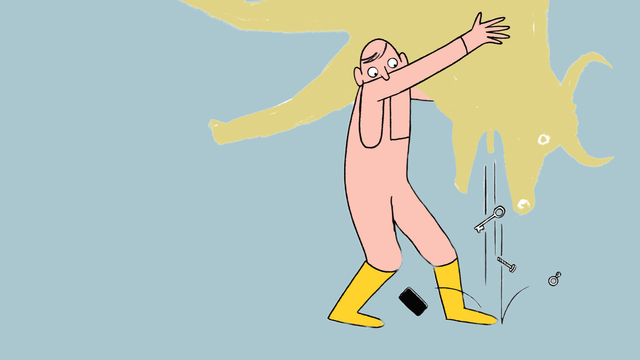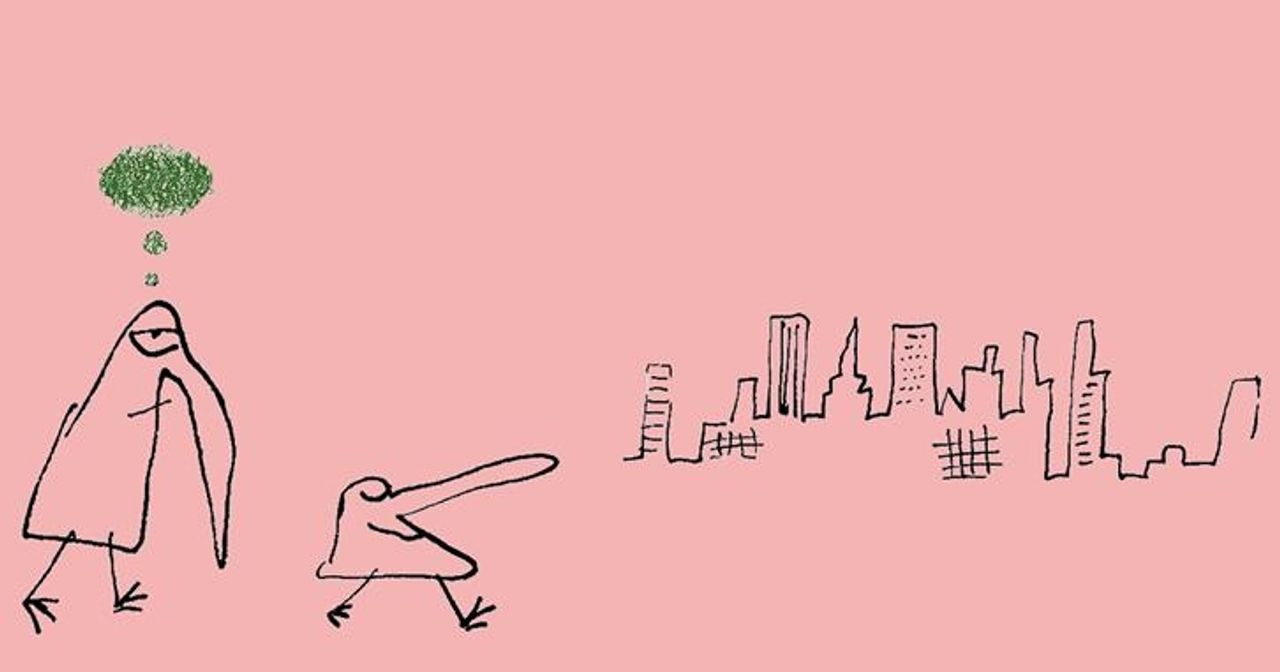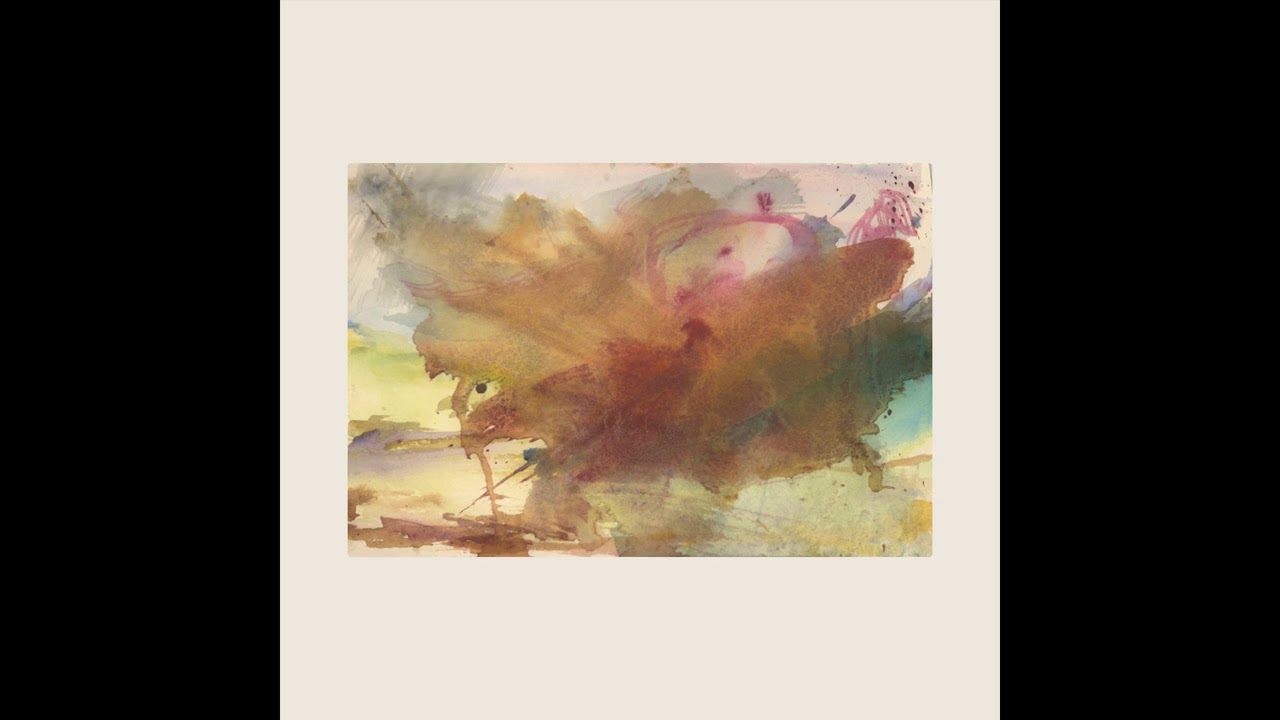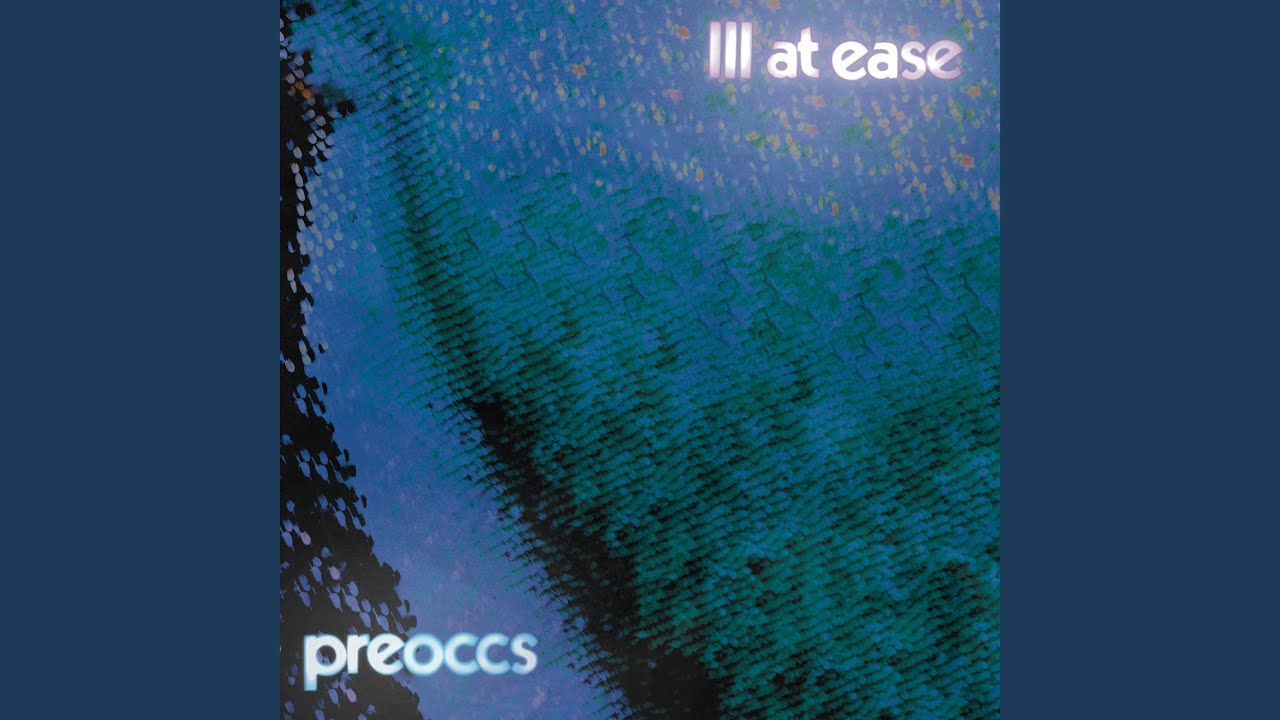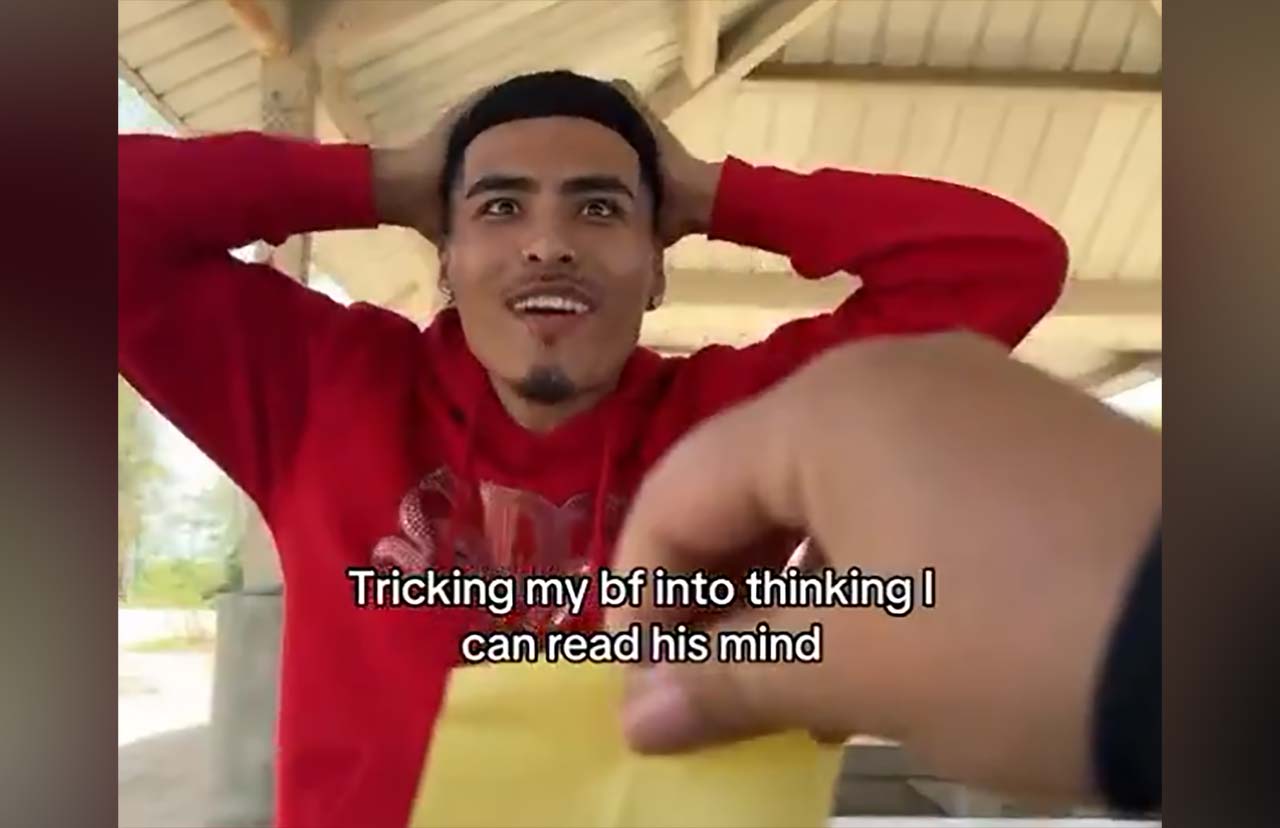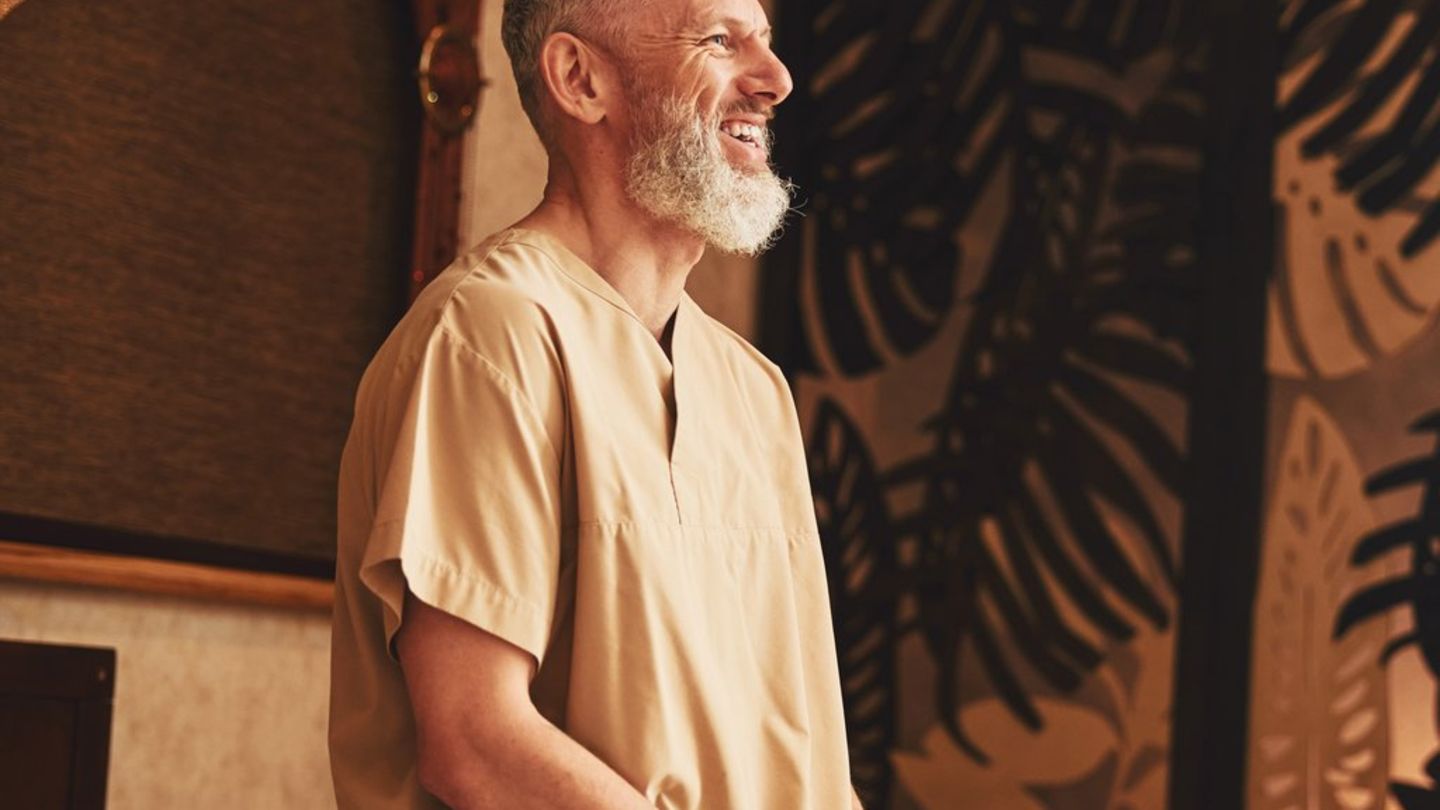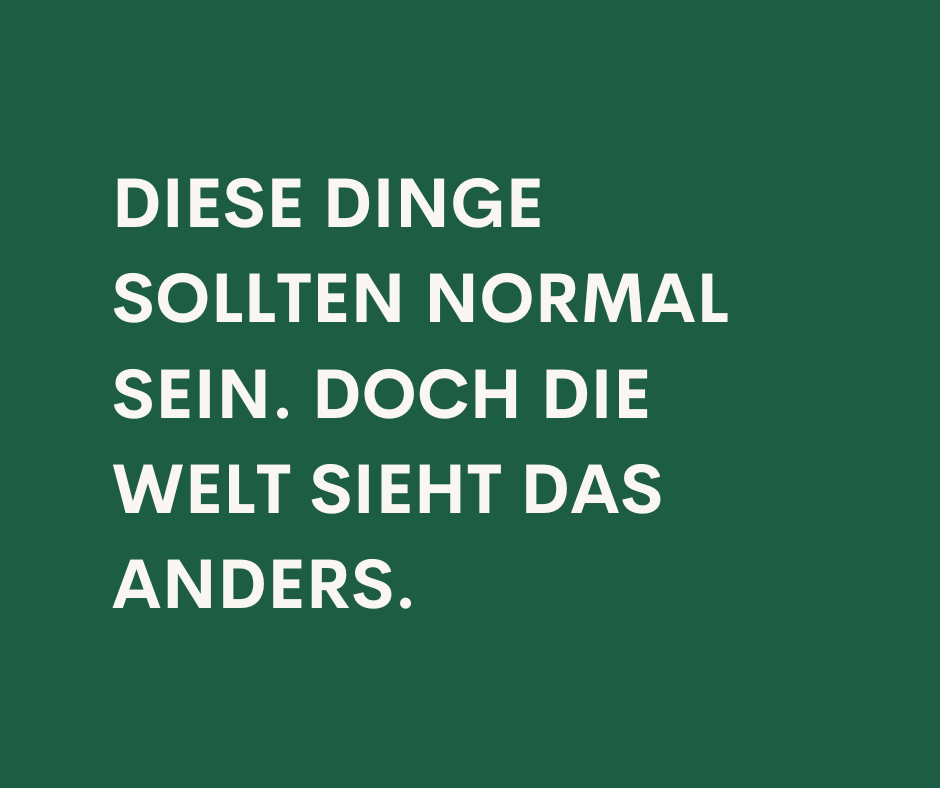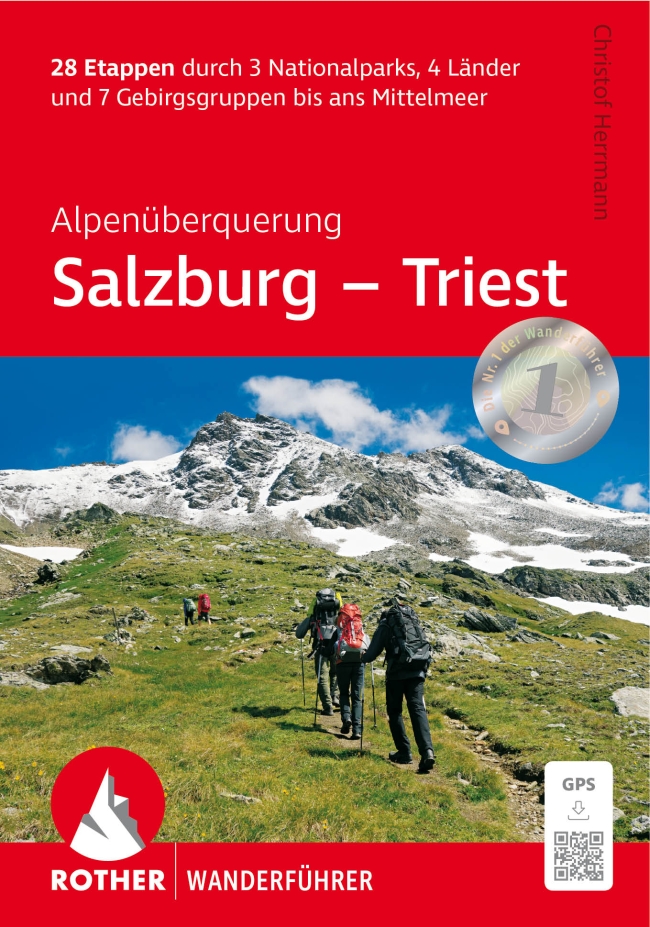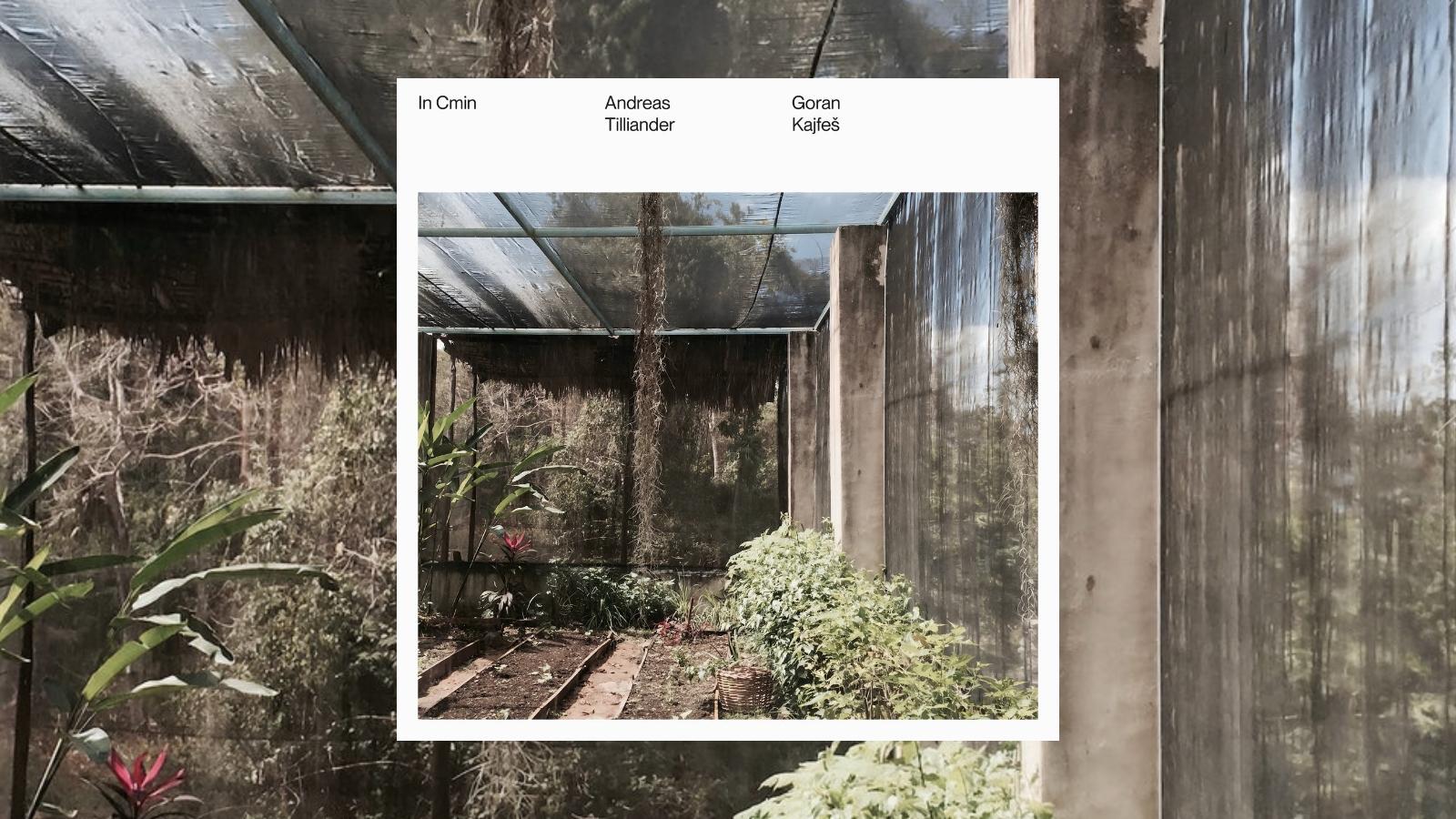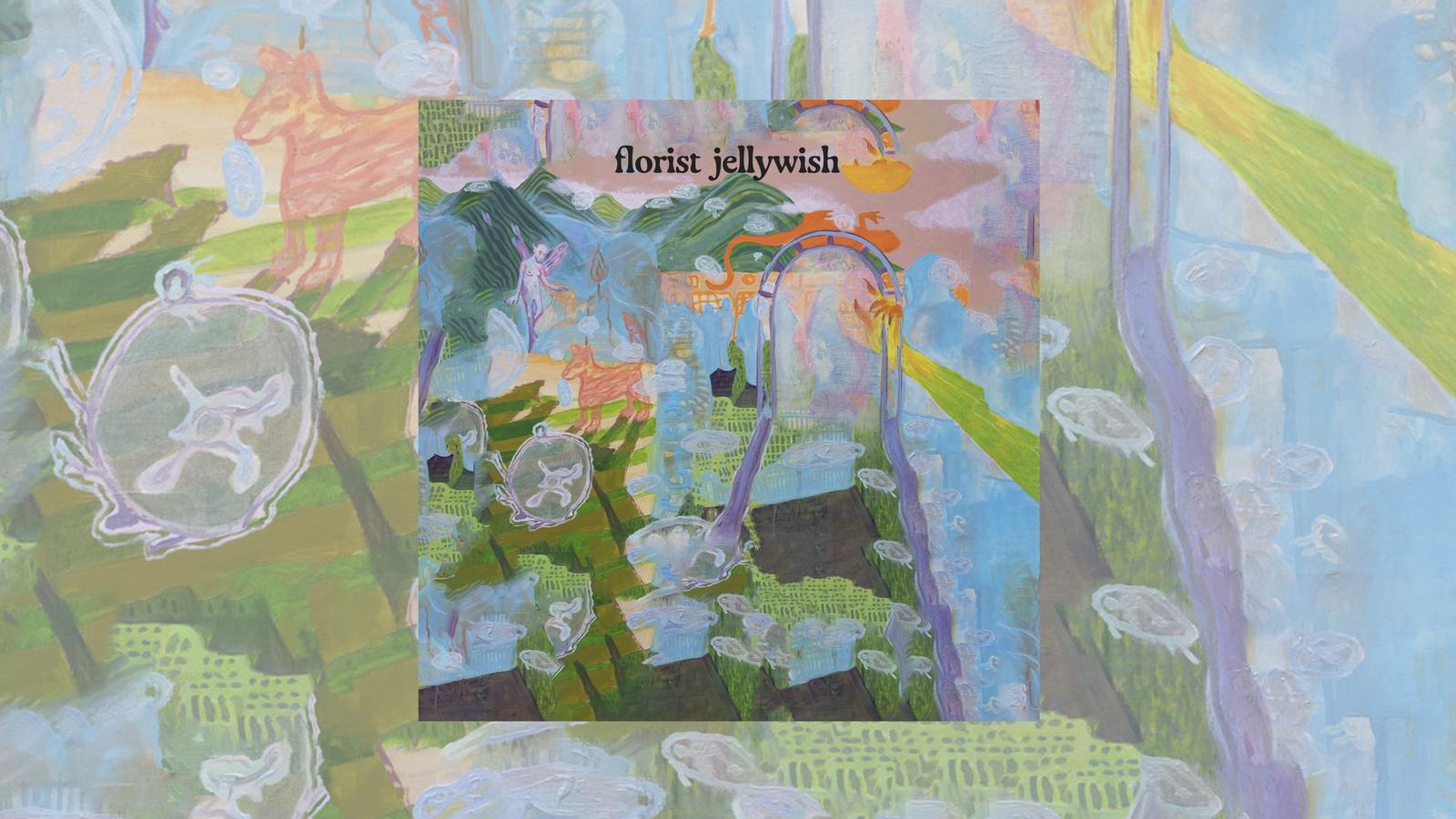Von Fehlgeburt bis Privatinsolvenz: Warum "Das bleibt in der Familie" nicht mehr gilt
Immer mehr Menschen teilen private, oft tabuisiert geglaubte Themen im Netz. Was macht es mit uns, dass sich unsere Schamgrenze immer weiter auflöst?

Immer mehr Menschen teilen private, oft tabuisiert geglaubte Themen im Netz. Was macht es mit uns, dass sich unsere Schamgrenze immer weiter auflöst?
"Das bleibt in der Familie", lautete früher ein ungeschriebenes Gesetz. Scheidungen, Geldsorgen, eine Schwangerschaft, die plötzlich keine mehr war, Krankheiten … So etwas wurde vorzugsweise diskret unter den Tisch gekehrt. Totgeschwiegen. "Das geht niemanden etwas an." Dabei hätte es vielen sicher gutgetan, sich die Sorgen mal von der Seele zu reden.
Heute wird das Netz von intimen Bekenntnissen geflutet: die Privatinsolvenz, die Chemotherapie, der Stuhlgang nach der Geburt ... Viele empfinden es als befreiend und empowernd, Tabus zu brechen und bestimmte Themen (endlich) aus der Schamecke zu holen.
Teilen als Therapie
So berichtete die Moderatorin Louisa Dellert in einem Interview über ihren exzessiven Porno-Konsum zum "Stressabbau". Ein anderes Mal präsentierte sie sich zusammen mit der feministischen Autorin Tara-Louise Wittwer im BH vor der Kamera, um auf ihre unterschiedlich großen Brüste aufmerksam zu machen – die Botschaft: "Das ist normal. Ihr müsst euch nicht dafür schämen". Dazu kreierte sie den Hashtag #unshame.
Model Anna Adamyan dokumentierte beinahe in Echtzeit ihre Kinderwunschreise mit elf künstlichen Befruchtungen auf Instagram; Anna Maria Ferchichi plaudert über ihr Intimleben mit Bushido ("Analsex? Heute erst gehabt. Mögen wir beide gerne"); die an MS erkrankte Christina Applegate spricht offen darüber, dass die jetzt Windeln tragen muss; Hilaria Baldwin, Ehefrau von Alec Baldwin, teilte mir ihren knapp eine Million Followern, dass bei ihrem ungeborenen Kind keine Herztöne mehr gemessen werden konnten und sie deshalb eine Fehlgeburt haben wird; Florence Pugh offenbarte in einem Interview, dass sie sich die gerade die Eier einfrieren lässt, weil sie nicht mehr auf den Richtigen warten will; Gianna Bacio dokumentierte auf Instagram ihren Weg vom positiven Schwangerschaftstest bis zur Abtreibung.
Wie viel Offenheit ist zu viel?
Ansichtssache, was hiervon unter Empowerment fällt und was unter too much information. In jedem Fall wäre eine derartige Offenheit wohl für die allermeisten unserer Eltern und Großeltern vermutlich noch undenkbar gewesen. Was macht es mit uns, dass heute immer mehr Menschen ihr Intimstes mit uns teilen und offenbar schamlos alles preisgeben, was sie bewegt? Und: Wie viel ist zu viel?
Wenn Frauen heute teilen, was früher tabu war – also Fehlgeburt, Körperveränderung, Angst – dann sei das kein „Oversharing“ – sondern Rückeroberung, Sichtbarmachung, Heilung", sagt die feministische Coachin und psychologische Beraterin Kathrin Fuchs. Und trotzdem: „Nicht alles, was unter #noshame läuft, ist echte Befreiung." Manches sei nur gut verpackte Inszenierung – Scham als Content, Schwäche im Filter. "Dahinter steckt die Sehnsucht nach Verbundenheit", glaubt Diane Hielscher, Gründerin der Plattform LifeXLab, in der es darum geht, wie wir unser Gehirn so formen können, dass es uns gut geht. "Wir zeigen alles von uns, damit andere sich melden und sagen: 'Ich hatte auch eine Fehlgeburt, ich bin auch pleite, ich habe auch Übergewicht!'" Verbundenheit sei existenziell wichtig für uns Menschen.
"Wenn ich zeige, was mich gerade beschäftigt, kann ich mich mit anderen verbinden, also meine Peergroup finden – Leute, die dasselbe Problem haben. Dadurch fühle ich mich weniger allein." In der Psychologie heiße das "normalisieren" – eine Formulierung, die mittlerweile auch häufiger in den sozialen Medien auftaucht: Let's normalize ... dies oder das. "Im schlechtesten Fall sind wir dadurch noch mehr damit beschäftigt, ständig zu gucken, was die anderen machen und verlieren durch das ständige Vergleichen unseren Fokus auf die Dinge, die wir wirklich machen wollen", warnt Diane Hielscher, Autorin des Buchs "Sei glücklich, älter wirst du sowieso".
Likes gegen Leid
Social Media hat unsere Schamgrenze sicherlich ausgedehnt – weil es nie einfacher war, Gleichgesinnte beziehungsweise eine wohlwollende (anonyme) Bubble zu finden. Dadurch fällt es uns leichter, uns zu öffnen und Geschichten zu teilen. Aber auch im wahren Leben werden die Leute zunehmend offener. Erst neulich traf ich eine alte, sehr entfernte Bekannte in der U-Bahn und erfuhr innerhalb weniger Minuten ALLES über ihre Scheidung, den Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex sowie den "Wahnsinns-Sex" mit ihrem neuen, 15 Jahre jüngeren Lover.
Scham als unsichtbares Korsett
Auch ich genieße zuweilen, mit Freundinnen offen und ungehemmt über Themen zu sprechen, die vor einigen Jahren noch in der gesellschaftlichen Tabuzone parkten. Selbst wenn man hinterher manchmal einen kleinen Offenbarungs-Kater hat und denkt: Puh, musste ich das wirklich erzählen? Aber ist es nicht eben wichtig, gewisse Dinge auch mal laut auszusprechen oder auszuschreiben, um gesellschaftspolitisch voranzukommen?
Vor allem Frauen haben lange genug geschwiegen, trugen die Scham wie ein unsichtbares Korsett. Dass endlich offen über psychische Erkrankungen, Essstörungen, Fehlgeburten gesprochen wird, ist überfällig und großartig. Wenn Influencerinnen über Therapien, ADHS oder den Kampf gegen Essstörungen reden, hilft das anderen: "Du bist nicht allein. Es ist okay, nicht okay zu sein".
Ist die Gen Z weniger schambefreit als sie tut?
Dabei ist Scham nicht immer schlecht. Sie hilft uns, unsere eigenen Grenzen und die anderer zu wahren. Nicht umsonst war "cringe" (frei übersetzt: "zum Fremdschämen") das Jugendwort des Jahres 2021. Sind vor allem die Jüngeren also doch gar nicht so schambefreit wie es durch die Social-Media-Brille scheint?
Tatsächlich kleben Hashtags wie #noshame immer öfter unter Banalitäten wie "Heute trage ich keine Mascara" oder "Ich esse Chips im Bett". Da wird der Zweitkredit für die Designermöbel ebenso "schamfrei" bejubelt wie die Kündigung des Bürojobs, um sich eine Yoga-Ausbildung auf Bali zu gönnen. Das ist dann weniger empowernd als vielmehr fishing vor compliments und Kooperationspartner:innen.
Frei und authentisch in der Lebensmitte
Vielleicht entwickeln viele uns erst in der Lebensmitte eine Reife und die innere Stärke, uns von äußerem Druck weniger beeindrucken zu lassen. Es ist uns egal, was andere von uns denken. Und der Drang, authentisch zu sein, ist größer, als gefallen zu wollen. „In der Lebensmitte beginnt für viele echte Schamfreiheit", glaubt auch die feministische Coachin Kathrin Fuchs. „Weil wir aufhören, gefallen zu wollen – und anfangen, uns selbst zu gehören.“ Nicht alles müsse geteilt werden. Aber alles dürfe sein.
So wie Jennifer Aniston, die mit 53 im "Allure"-Magazin erstmals darüber sprach, warum sie keine Kinder hat. Ein Thema, über das die Klatschpresse Zeit ihres Lebens wild spekuliert hatte. Nein, sie sei keine karrieregeile Workaholic, sie hätte sich sehr gewünscht, Mutter zu werden, doch leider hätte künstliche Befruchtung bei ihr nicht funktioniert. Das sei aber nicht der Grund gewesen, warum Brad Pitt sie verlassen habe. Definitiv eine Geschichte, die nicht nur in der Familie bleiben sollte, sondern Millionen Frauen weltweit inspiriert und empowert hat.